AWMF online |
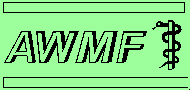 |
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften |
AWMF online |
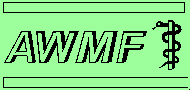 |
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften |
| AWMF-Leitlinien-Register | Nr. 032/014 | Entwicklungsstufe: | 1 + IDA |
|---|
Zitierbare Quelle: Grundlagen der Chirurgie G70, Beilage zu den Mitteilungen der
Dt. - Ges. f. Chirurgie, Heft 3/1996, Balingen 1996
- Forum Dt. Krebsgesellschaft (14) 2/1999, S. 108-113
- Dt. Krebsgesellschaft (Hrsg.): Qualit�tssicherung in der Onkologie - Interdisziplin�re
Leitlinien 1999: Diagnose und Therapie maligner Erkrankungen. M�nchen; Bern; Wien; New
York 1999, S. 80 ff
Erg�nzende Untersuchungen
Pr�operative morphologische Diagnostik
W�nschenswert ist die Feinnadelpunktion, die mit hoher Sensitivit�t die Unterscheidung zwischen benignen und malignen kalten Knoten der Schilddr�se und unter Umst�nden auch bereits eine spezifische Tumorklassifikation (z. B. papill�res Karzinom) erlaubt. Ein negativer Befund schlie�t ein Karzinom nicht aus. Dies gilt insbesondere f�r follikul�re Tumoren (follikul�res Adenom versus follikul�res Karzinom), deren Dignit�t zytologisch nicht bestimmbar ist. Aus diesem Grund beschr�nkt sich die zytologische Diagnostik hierbei auf die Feststellung einer "follikul�ren Neoplasie", ein Befund, der in aller Regel die operative Aufkl�rung zur Konsequenz hat.
Sie ist indiziert bei:
Ausnahmen
Lymphknotendissektion
Das Lymphablaufgebiet der Schilddr�se kann in ein zentrales, laterales und mediastinales Kompartiment unterteilt werden. Das zentrale Kompartiment umfa�t die Lymphknotengruppen Nr. 1, 2 und 8, das laterale die Lymphknotengruppen Nr. 3 - 7 ([4], Abb. 1).
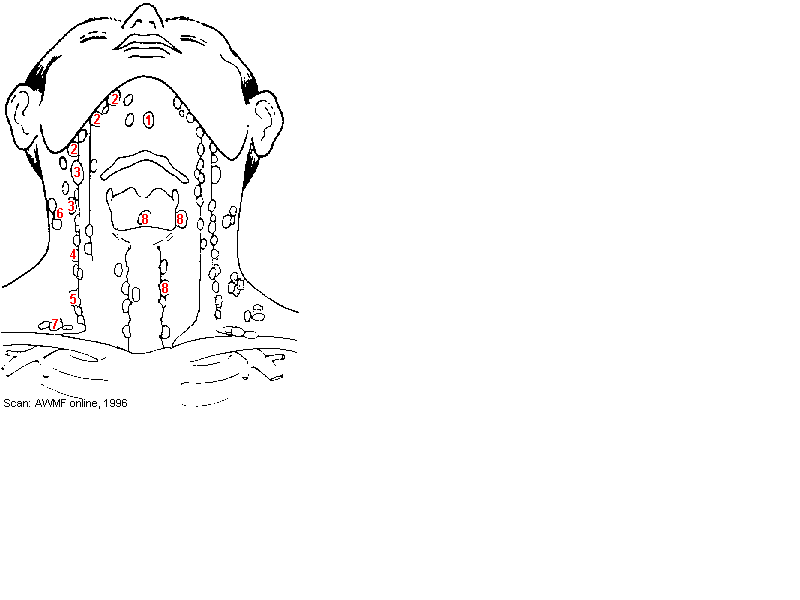 |
Zentrale Lymphknoten: Nr. 1, 2 und 8 Laterale Lymphknoten: Nr. 3 - 7 Bei der zentralen Lymphknotendissektion werden nur die Lymphknoten der Gruppe Nr. 8 entfernt. Aus UICC (1993) TNM-Supplement 1993 |
Die Thyreoidektomie wegen eines Karzinoms schlie�t die zentrale Lymphknotendissektion ein. Dabei werden die perithyreoidalen, pr�laryngealen und pr�trachealen Isthmus-nahen Lymphknoten (Nr. 8) entfernt; die submentalen (Nr. 1) und submandibul�ren (Nr. 2) Lymphknoten werden nicht prophylaktisch entfernt.
Bei palpablen oder sonografisch verd�chtigen lateralen Halslymphknoten erfolgt die
systematische, ipsilaterale, ggf. auch kontralaterale Dissektion der lateralen
Halslymphknoten.
Wegen der H�ufigkeit von Lymphknotenmetastasen bei fortgeschrittenem differenzierten
Karzinom (T3/4) (65 - 90 %) [3] wird von manchen Autoren [2] die prinzipielle ipsilaterale
Lymphknotendissektion unabh�ngig vom Palpations- und Sonografiebefund empfohlen.
Bei sporadischem medull�ren Karzinom erfolgt obligat die ipsilaterale, bei famili�rem
Karzinom die beidseitige systematische laterale Halslymphknotendissektion.
Ausnahme:
Bei allein durch Genscreening identifizierten Patienten erfolgt lediglich die
Thyreoidektomie mit zentraler Lymphknotendissektion.
Die mediastinale Lymphknotendissektion erfolgt individuell, abh�ngig von der vorliegenden Situation und umfa�t die oberen tracheooesophagealen Lymphknoten und den Thymus mit den anliegenden Lymphknoten (anteriore mediastinale Lymphknoten).
Multiviszerale Eingriffe
Bei Invasion von Nachbarstrukturen durch differenzierte Schilddr�senkarzinome kann
eine Mitresektion indiziert sein, wenn hierdurch eine vollst�ndige Tumorentfernung
(R0-Resektion) erreichbar wird (Oesophagus, Trachea, Gef��e).
Bei organ�bergreifendem undifferenzierten Karzinom sollte nach histologischer Sicherung
der Diagnose eine multimodale Therapie erfolgen (s. u.)
Intraoperative Schnellschnittdiagnostik
Da dieser Nachweis h�ufig erst nach kompletter Aufarbeitung der follikul�ren Tumoren im Paraffinschnitt gelingt, mu� die endg�ltige Dignit�tsbestimmung follikul�rer Tumoren auch im Schnellschnitt h�ufig offenbleiben.
Postoperative patho-histologische Diagnostik
Vom Alter und von einzelnen klinischen Parametern abgesehen wird die Prognose maligner Schilddr�sentumoren im wesentlichen von histomorphologischen Parametern bestimmt. An die postoperative histologische Aufarbeitung sind deshalb folgende Minimalanforderungen zu stellen:
Die Radiojodtherapie ist bei allen papill�ren und follikul�ren Karzinomen nach Thyreoidektomie mit oder ohne laterale Lymphknotendissektion 4 - 6 Wochen nach Operation (Anstieg des basalen TSH Spiegels �ber 30 mE/l, d.h. zwischenzeitlich keine Levothyroxin-Medikation) indiziert. Eine Radiojodtherapie ist nicht erforderlich bei papill�rem Karzinom pT1a nach eingeschr�nkter radikaler Operation und nicht angezeigt bei medull�rem Karzinom und undifferenziertem Karzinom.
Ziel der Radiojodtherapie nach totaler Thyreoidektomie ist neben der Ablation von evtl. noch vorhandenem restlichen Schilddr�sengewebe (z. B. Lobus pyramidalis) der Nachweis bzw. Ausschlu� von speichernden Metastasen. Hierzu werden Standardaktivit�ten zwischen 2,5 und 5 GBq 131-J verabreicht. Alternativ wird hierzu empfohlen, zuvor ein Ganzk�rperszintigramm mit 0,5 bis 1,0 GBq 131-J durchzuf�hren und die Ablationstherapie nur anzuschlie�en, wenn Restschilddr�sengewebe nachzuweisen ist. Diese erfolgt dann nach individueller Berechnung, wobei die Herddosis mehr als 500 Gy betragen soll.
Nach unvollst�ndiger Schilddr�senentfernung wegen eines differenzierten Karzinoms ist vor Einsatz der Radiojodtherapie individuell �ber einen Wiederholungseingriff zu entscheiden.
Eine perkutane Strahlentherapie ist indiziert
Adjuvante perkutane Strahlentherapie
Nach R0-Resektion und ad�quater Radiojodtherapie differenzierter Karzinome ist in der
Regel eine adjuvante perkutane Strahlentherapie nicht erforderlich. Sollte sie in Studien
erwogen werden, ist ein negativer szintigrafischer Befund Voraussetzung.
Nach operativer Therapie des medull�ren Karzinoms ist die Wirksamkeit einer adjuvanten
perkutanen Strahlentherapie nicht erwiesen.
Prim�re Non-Hodgkin-Lymphome der Schilddr�se
Prim�re Non-Hodgkin-Lymphome der Schilddr�se werden nach histologischer Sicherung einer
perkutanen Strahlentherapie in kurativer Zielsetzung zugef�hrt.
Hier werden 36 - 40 Gy bei Lymphomen mit niedrigem Malignit�tsgrad und 46 - 50 Gy bei
solchen mit hohem Malignit�tsgrad im Zielvolumen verabreicht.
Medikament�se Therapie
Bei papill�rem und follikul�rem Karzinom erfolgt die Gabe von Levothyroxin in
TSH-suppressiver Dosierung (basaler TSH-Spiegel 0,1 - 0,2 mU/l bzw. niedrig normal bei
nicht differenzierten Karzinomen) lebenslang. Bei C-Zell-Karzinom und anaplastischem
Karzinom erfolgt die Substitutionsbehandlung mit etwa 150 �g/die. Die �berwachung der
Therapie soll anhand des basalen TSH und Gesamt-T3 oder -FT3
erfolgen.
Nachsorge bei differenzierten Karzinomen
Die Nachsorge differenzierter Schilddr�senkarzinome sollte risikoorientiert durchgef�hrt
werden. Ein m�gliches Schema zeigt die Tabelle 1. Das halbj�hrlich, nach 5 Jahren
j�hrlich, durchzuf�hrende Basisprogramm umfa�t:
Anamnese, klinischen Befund, Sonografie des Halsbereiches und die Bestimmung des
Thyreoglobulinspiegels.
Die 131-Jod Ganzk�rperszintigrafie erfolgt 3 - 4 Monate nach der Radiojodtherapie sowie 1
Jahr danach. Nur bei Patienten mit erh�htem Risiko kann gegebenenfalls ein 131-Jod
Ganzk�rperszintigramm etwa alle 2 Jahre empfohlen werden.
Bei Tg-Anstieg dienen zur Lokalisation des Rezidivs 131-Jod-Ganzk�rperszintigrafie,
Sonografie und Computertomografie von Hals und Thorax, die Sonografie des Abdomens und die
Szintigrafie mit 99 m Tc-MIBI oder 18 FDG (PET).
| Tabelle 1: Risikoorientierte Nachsorge des differenzierten Schilddr�senkarzinoms | |
| Niedriges Risiko (3/4 der Patienten) pT1-T3 pN0 M0 pT1-T3 pN1 M0 |
Hohes Risiko (1/4 der Patienten) pT4, jedes pN, jedes M jedes pT pN2-N3, M0 jedes pT jedes pN M1 |
| Nach Beweis der vollst�ndigen Ablation durch 2-maligen 131-J-Scan | |
| Basisprogramm alle 6 Monate, ab 5. Jahr j�hrlich Klinik Sonografie Tg unter T4 R�ntgen Thorax 131-J-Scan |
Basisprogramm alle 6 Monate, ab 5. Jahr j�hrlich Klinik Sonografie Tg unter T4 R�ntgen Thorax 131-J-Scan |
Nachsorge bei medull�rem Karzinom
Nach Operation eines medull�ren Karzinoms mu� eine heredit�re Form durch
Familienscreening belegt oder ausgeschlossen werden und beim betroffenen Patienten die
Suche nach assoziierten Endokrinopathien (MEN II, Phaeochromozytom, prim�rer
Hyperparathyreoidismus) erfolgen.
Die Nachsorge bei medull�rem Karzinom schlie�t in der Verlaufskontrolle die Bestimmung
des Calcitoninspiegels und des CEA-Werts im Serum ein. Bei Anstieg der Tumormarker kann
die weitere Abkl�rung durch Technetium 99 m MIBI-Szintigrafie erfolgen.
Bei Lymphknoten- oder Lokalrezidiv sollte prim�r die chirurgische Behandlung angestrebt werden. An den Wiederholungseingriff schlie�t sich die Radiojoddiagnostik und ggf. -therapie an. Bei progressivem, irresektablen, nicht speichernden Lokalrezidiv ist eine perkutane Strahlentherapie oder im Einzelfall eine Chemotherapie (s. u. Fernmetastasen) oder Radiochemotherapie in Abstimmung mit einem Zentrum zu erw�gen.
Bei singul�ren Fernmetastasen in Knochen, Lunge oder Leber ist die vollst�ndige operative Entfernung anzustreben. Sofern Inoperabilit�t besteht, erfolgt beim papill�ren und follikul�ren Karzinom bei Jodspeicherung eine Radiojodtherapie. Bei fehlender oder unzureichender Radiojodspeicherung kann der Versuch einer perkutanen Strahlentherapie unternommen werden, sofern Beschwerden bestehen. Auch bei symptomatischen Fernmetastasen des medull�ren Schilddr�senkarzinoms ist die perkutane Strahlentherapie indiziert. Je nach Lokalisation der Metastasen k�nnen Bestrahlungsdosen von 30 Gy (10 x 3 Gy) in 2 Wochen oder 45 - 50 Gy (25 x 1,8 - 2 Gy) in 5 Wochen verabreicht werden.
Bei diffuser Metastasierung kann im Einzelfall in Abstimmung mit einem Zentrum eine Mono- oder Kombinationschemotherapie oder auch eine Radiochemotherapie verabreicht werden. Als Substanzen kommen in Betracht Adriamycin (Dosis 60 bis 75 mg/m�) alle 3 Wochen oder Cisplatin (Dosis 75 mg/m�) alle 3 Wochen. Diese Substanzen k�nnen auch kombiniert werden unter entsprechender Dosisreduktion.
Zur symptomatischen Therapie einer calcitoninbedingten Diarrhoe empfiehlt sich Octreotide (Sandostatin) 3 x 100 - 3 x 400 �g/die s.c.
Bei organ�berschreitendem undifferenzierten Karzinom sollten die Patienten nach
Diagnosesicherung einem multimodalen Therapiekonzept (Radiochemotherapie und Operation)
zugef�hrt werden.
Diese multimodalen Konzepte sollten m�glichst an Zentren mit entsprechenden Erfahrungen
durchgef�hrt werden.
Den Patienten sollte vor der Entlassung aus der Prim�rtherapie mitgeteilt werden, wo,
wann und welche Nachsorgeuntersuchungen erfolgen m�ssen.
�ber die Notwendigkeit station�rer Rehabilitationsma�nahmen sollte individuell
entschieden werden. Eine Indikation kann z. B. gegeben sein bei Bewegungseinschr�nkungen
nach Halslymphknotendissektion oder schwieriger Hormonsubstitution nach Thyreoidektomie
oder psychosozialen Problemen.
Im allgemeinen sind die Patienten nach abgeschlossener Wundheilung und bei gut
eingestellter Hormonsubstitution, sofern kein Hinweis auf ein Rezidiv besteht
(Vollremission), wieder voll arbeitsf�hig. Zu einer Rente - auch einer Rente auf Zeit -
sollte nur dann geraten werden, wenn die Auswirkungen der Thyreoidektomie so erheblich
sind, da� eine T�tigkeit in dem ausge�bten Beruf nicht mehr m�glich ist oder eine die
Leistungsf�higkeit beeinflussende Metastasierung vorliegt.
Der Grad der Behinderung (GdB) ist nach den Funktionsst�rungen zu bemessen. Besonders bei
jungen, in der Ausbildung befindlichen Patienten sollte jedoch auf die M�glichkeit
langfristiger Nachteile von "Verg�nstigungen" f�r Schwerbehinderte hingewiesen
werden (z. B. Schwierigkeiten, eine neue oder andere Arbeitsstelle zu finden).
Erarbeitet von den Arbeitsgemeinschaften der Deutschen Krebsgesellschaft:
Chirurgische Arbeitsgemeinschaft f�r Onkologie (CAO)
Arbeitsgemeinschaft f�r Internistische Onkologie (AIO)
Arbeitsgemeinschaft f�r Radiologische Onkologie (ARO)
Arbeitsgemeinschaft f�r Rehabilitation und Nachsorge (ARNS)
Mitglieder der Arbeitsgruppe waren:
Prof. Dr. med. H. Delbr�ck, Wuppertal (ARNS)
Prof. Dr. med. H. Dralle, Halle (CAEK)
Prof. Dr. med. F.W. Eigler, Essen (CAO)
Prof. Dr. med. H. Gabbert, D�sseldorf (Pathologie)
Prof. Dr. med. P. Georgi, Heidelberg (Deutsche Gesellschaft f�r Nuklearmedizin)
Prof. Dr. med. P. E. Goretzki, D�sseldorf (CAO)
Prof. Dr. med. P. Hermanek, Erlangen (ISTO, Pathologie)
Prof. Dr. med. D.K. Hossfeld, Hamburg (AIO)
Prof. Dr. med. Th. Junginger, Mainz (CAO)
Prof. Dr. med. K. Mann, Essen (Deutsche Gesellschaft f�r Endokrinologie)
Prof. Dr. med. H.J. Meyer, Solingen (CAO)
Prof. Dr. med. H. Pichlmaier, K�ln (CAO)
Prof. Dr. med. H.D. R�her, D�sseldorf (CAO)
Prof. Dr. med. G. Schmitt, D�sseldorf (ARO)
PD Dr. med. M.H. Seegenschmidt, Essen (ARO)
Prof. Dr. med. W. Stock, D�sseldorf (CAO)
Beratend haben mitgewirkt:
Prof. Dr. med. H.G. Beger, Ulm (CAO)
Prof. Dr. med. M. Rothmund, Marburg (CAO)
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT)
Deutsche Gesellschaft f�r Chirurgie, Chirurgische Arbeitsgemeinschaft f�r endokrine
Chirurgie (CAEK)
Deutsche Gesellschaft f�r Endokrinologie, Sektion Schilddr�se
Deutsche Gesellschaft f�r Innere Medizin
Deutsche Gesellschaft f�r Nuklearmedizin
Deutsche Gesellschaft f�r Pathologie
Deutsche Gesellschaft f�r Radioonkologie
Deutsche R�ntgengesellschaft
Koordinator
Prof. Dr. med. Th. Junginger, Mainz (CAO)
Korrenspondenzadresse:
Klinik und Poliklinik f�r Allgemein und Abdominalchirurgie
der Johannes-Gutenberg-Universit�t
Langenbeckstra�e 1
55101 Mainz
Erstellungsdatum: November 1998
Revision geplant: Januar 2000
Die "Leitlinien" der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften sind
Empfehlungen f�r �rztliches Handeln in charakteristischen Situationen. Sie schildern
ausschlie�lich �rztlich-wissenschaftliche und keine wirtschaftlichen Aspekte. Die
"Leitlinien" sind f�r �rzte unverbindlich und haben weder haftungsbegr�ndende
noch haftungsbefreiende Wirkung.
Besonders bei der kurativen Behandlung maligner Erkrankungen sollten Abweichungen von den
Leitlinien im Einzelfall begr�ndet sein.